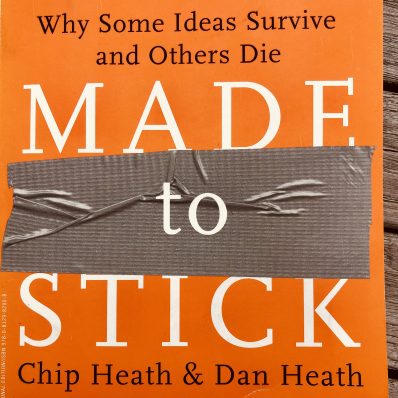Anschnallen bitte. Die Welt verändert sich. Wer an Stabilität glaubte, wird aktuell eines besseren belehrt. Die Wahlergebnisse auf EU-Ebene und auch die politische Disruption in Deutschland zeichnen ein klares Bild. Ein Bild von Veränderung. Geprägt wird es durch die nächste Generation.
Wer ist Next GEN?
Es sind nicht nur die 20-30 jährigen, sondern auch die vierziger und fünfziger. Alle Menschen, die nicht stehen geblieben sind, die sich selbst und unsere Gesellschaft weiter formen und transformieren. Es beginnt bei Schülermärschen und endet bei professionellen digitalen Transformationen in großen Leistungsorganisationen. Quer durch alle Schichten und Altersklassen ergeht erneut ein Ruck und nicht mehr lange, dann wird dieser Ruck zu einer neuen Politik, zu neuen Organisationsformen und neuen Regeln führen, die unser Zusammenleben organisieren.
Wie bereiten wir uns darauf vor?
„Change Management“ alleine ist keine Lösung. Soviel vorweg. Wir leben in einem Umfeld von Geschwindigkeit, Vernetzung und Unschärfe und hier braucht es umfassendere Instrumente zur Transformation. Billige Schulungs- und Trainingskonzepte gehören in die Schublade von gestern. Auch dann, wenn es Videotrainings sind. Gäääääähn. Ist das alles? Soll das innovativ sein? Transformation ist weit aus mehr, tiefgreifender, es beeinflusst Denkhaltungen, Handlungen und gesellschaftliche Entwicklungen und wenn wir nicht aufpassen im Management, sind wir schneller betroffene als Gestalter.
Der Startpunkt – Standortbestimmung
Wissen Sie eigentlich, wo Sie und Ihre Leistungsorganisation überhaupt steht? Wie nehmen Kunden das Unternehmen war? Wie Mitarbeiter? Wie Partner? Es reicht nicht mehr aus, Customer Journeys zu designen und umzusetzen, wenn die Journey für alle Stakeholder nicht mal ansatzweise auf der Agenda steht, also die Mitarbeiter Journey, die Partnerjourney. Erst der ganzheitliche Blick auf alle Beteiligten und deren Aussteuerung schafft die Basis für zukünftige Erfolge. Mal im Ernst, wie messen Sie den Standpunkt konkret? Mit welchen Instrumenten?
Eine Antwort: Digital Maturity Model
Nur wer weiss, wo er genau steht, kann einen Weg zum Ziel aufzeigen. Es wäre doch wahnsinnig irgendwo hin zu laufen, wenn wir gar nicht wissen, wo wir stehen, wie fit wir sind, auf welchem Level wir uns überhaupt befinden. Sie müssen mit der Feststellung des eigenen Standorts, dem Reifegrad der Leistungsorganisation beginnen. Eine Möglichkeit ist das Digital Maturity Model. Ich werde hier weiter davon berichten. Freuen Sie sich auf die nächsten Beiträge.